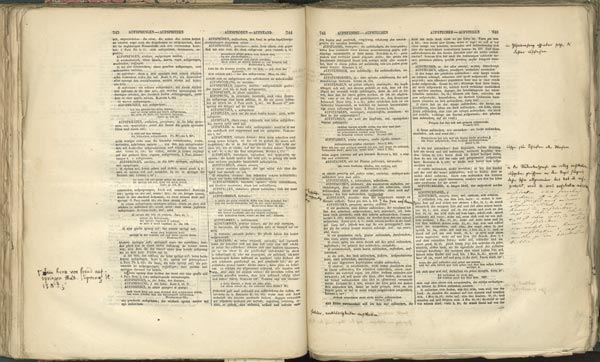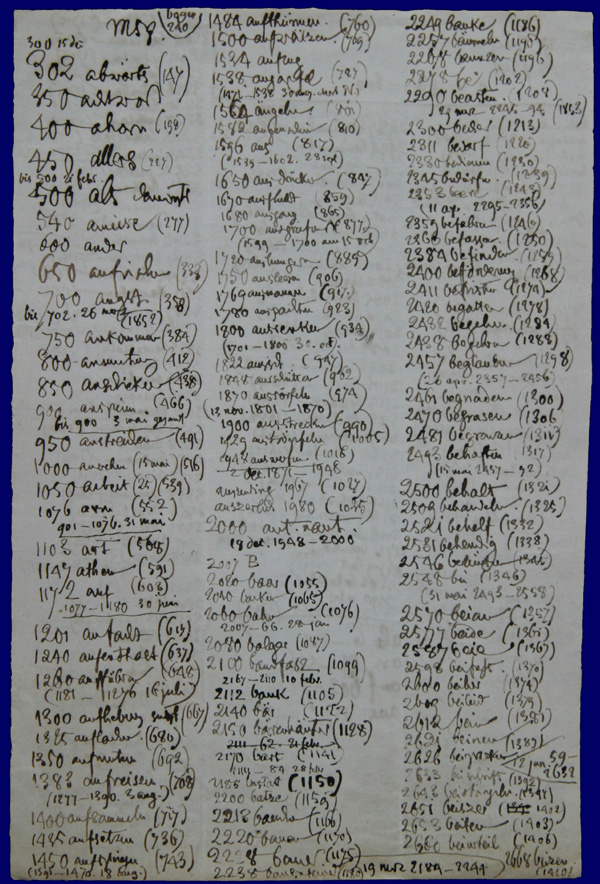|
(Abbildung: Biblioteka Jagiellonska Kraków)
Aus den
zwei Bänden, die bisher Wilhelm Grimm zugeschrieben wurden, liegen
mittlerweile Probescans der ersten Lieferung von 1852, A bis ALLVEREIN,
und vom Anfang des Buchstabens D vor. Die Überraschung ist: im Bereich
A bis ALLVEREIN gibt es keine einzige Notiz Wilhelm Grimms, und auch im
Bereich des D sind nur ganz wenige Notizen von ihm zu sehen. Es
ist ganz eindeutig: Bei diesen bereits gescannten Teilen der
Bände ”Wilhelm Grimms” handelt es sich größtenteils um eine Sammlung
von Korrekturbögen, die Arbeitsprozesse aus der Zeit vor der
Publikation des Wörterbuchs wiedergeben. Die meisten Notizen stammen
hier aus dem Hirzel-Verlag in Leipzig, vom Korrektor Rudolf Hildebrand,
der später einer der Fortsetzer der Wörterbuchs wurde, vom Verleger
Salomon Hirzel, vereinzelt auch von dessen Schwager Karl Reimer, der
das Wörterbuch angeregt und in der Anfangsphase ab 1838 das Wörterbuch
verlegerisch mit vorbereitet hatte.
Von Jacob Grimm gibt es in
diesem Exemplar - soweit bisher gescannt - im Bereich des A vereinzelt
Notizen, von Wilhelm Grimm im Bereich des D. Das erklärt sich aus ihrem
jeweiligen Arbeitspensum: Jacob Grimm lieferte 1852 bis 1855 A bis C,
Wilhelm Grimm übernahm das D, Jacob Grimm stieg später wieder mit E und
F ein. Sie bekamen anscheinend aus Leipzig zwei Exemplare
Korrekturbögen, eins mit den Notizen und Anfragen aus dem Verlag und
ein anderes ohne Notizen, auf das sie ihre eigenen Korrekturen und ihre
Ansichten zu den Leipziger Vorschlägen und Anfragen notierten. Diese
letztgenannten Korrekturbögen mit ihren eigenen Korrekturen schickten
sie dem Verlag zurück, von wo sie in die Druckerei gegeben und in den
Satzspiegel eingearbeitet wurden. Auch von den Korrekturbögen mit den
Entscheidungen der Grimms ist ein großer Teil erhalten. Sie befinden
sich in der Staatsbibliothek zu Berlin. (Einige zusätzliche Blätter
dieser Art tauchten im Januar aus Anlaß der zahlreichen Presseberichte
in Privatbesitz auf und werden nun ebenfalls der Berliner
Staatsbibliothek übergeben.)
Wie konnte es aber dazu kommen, daß
die zwei Bände, die (wie wir jetzt annehmen können) Korrekturbögen
enthalten, als das Handexemplar Wilhelm Grimms galten? Diese
Zuschreibung geht auf den Sohn Wilhelm Grimms, Herman Grimm, zurück.
Dieser brachte die neun Bände, die sich heute in Krakau befinden, 1898
persönlich in die Königliche Bibliothek Berlin, damals noch in dem
unter Friedrich II. erbauten Haus am Berliner Opernplatz. Der Direktor
der Bibliothek notierte: ”Die beiden stärkeren Bände sind das Exemplar
Wilhelms, die sieben dünneren das Jakobs” (zit. nach: Brüder Grimm
Gedenken 16). Offenbar hatte Herman Grimm dies bei der Übergabe so
mitgeteilt. Worauf seine Annahme gründete, läßt sich zur Zeit noch
nicht eindeutig beantworten. Höchstwahrscheinlich ist dafür aber die in
den Korrekturnotizen sehr zierliche Handschrift des Korrektors Rudolf
Hildebrand verantwortlich, die auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit
der Handschrift Wilhelm Grimms hat, auf den zweiten Blick aber auch
deutliche Unterschiede zu ihr aufweist. Ein Vergleich mit Briefen
Hildebrands aus der ersten Hälfte der 1850er Jahre ergab zweifelsfrei,
daß er und nicht Wilhelm Grimm Autor der zahlreichen Notizen ist,
die man in den Probescans aus diesen beiden Bänden sehen kann. So endet
möglicherweise 2006 eine Legende über diese zwei Bände, die 1898 ihren
Ausgang beim Sohn Wilhelm Grimms nahm - um Tatsachen Platz zu machen,
die nicht weniger spannend sind. Denn vom Ausmaß des intensiven Dialogs
zwischen Verlag und den beiden Autoren Grimm in Berlin über
Einzelheiten der Wortartikel konnte man bisher kaum ein genaues und
einigermaßen vollständiges Bild haben. Die Dokumente über die
Mitwirkung des Korrektors und des Verlegers haben aber bereits die
Brüder Grimm bewahrenswert gefunden und, soweit aus den bisher
ausgewerteten Proben ersichtlich, in den zwei Bänden gesammelt, die in
Krakau wieder aufgefunden wurden und die die ersten zwei der neun dort
vorhandenen sind.
Auch die Manuskripte der Brüder Grimm für das
Wörterbuch sind erhalten, größtenteils in der Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen. Des weiteren sind die Briefwechsel
mit den Verlegern des Wörterbuchs, Karl Reimer und Salomon Hirzel,
vollständiger erhalten (und zugänglich) als sonstige
Verlegerbriefwechsel der Brüder Grimm. Auch die Briefwechsel mit den
Exzerptoren, die den Brüdern Grimm Hilfe leisteten, sind weitgehend
erhalten, wie beispielsweise der in der kritischen Briefausgabe bereits erschienene mit dem Göttinger Exzerptor Universitätssekretär Gabriel Riedel.
Belegzettel für das Wörterbuch aus der Grimm-Zeit gibt es noch in
Bibliotheken, Archiven und Museen, vor allem aber bei der Berliner
Arbeitsstelle des Wörterbuchs. Bücher, aus denen die Brüder Grimm
selbst für das Wörterbuch exzerpiert haben und in denen man Spuren
davon finden kann, bewahren beispielsweise die Berliner
Universitätsbibliothek und das Museum Haldensleben. Eindeutig ist es
beispielsweise bei einer in Haldensleben vorhandenen Lessing-Ausgabe
und bei den dort sogar in zwei verschiedenen Ausgaben vorhandenen
Werken Christian Fürchtegott Gellerts der Fall.
Somit ist die
Arbeit der Brüder Grimm an ihrem Wörterbuch so gut nachvollziehbar wie
die an keinem anderen ihrer Werke. Dies läßt sich noch verallgemeinern:
für kaum ein anderes ähnliches Werk jener Epoche dürften die
Arbeitsprozesse noch so gut rekonstruierbar sein. Das entscheidende
große Stück des Puzzles, das bisher fehlte, sind die Krakauer Exemplare
des Wörterbuchs aus dem Besitz der Brüder Grimm. Nun aber ist es
möglich, die spannende Geschichte der wissenschaftlichen,
organisatorischen und verlegerischen Arbeit an so einem
Jahrhundertwerk, wie sie um 1850 / 60 aussah, neu zu schreiben.
Die
optisch attraktivsten und an Neuem gehaltreichsten unter all diesen
Materialien sind zweifellos die sieben Bände der Handexemplare Jacob
Grimms mit seinen Nachträgen zum Wörterbuch. Allein für den Bereich der
ersten Lieferung notierte er etwa 330 neue Stichwörter, deren Aufnahme
in eine spätere Ausgabe er erwogen hätte, von AALKISTE über
ABENDGOLDGEWÖLK und ABENDRAST, ABGESCHLAGENHEIT und ABGRUNDSUNGEHEUER,
ABSCHIEDSLIEDCHEN und ABSCHRÄGUNG, AFFENTHIER und AHNENSTAMM bis
ALLGEHORSAM und ALLVERBREITUNG. Die Liste der ca. 330 lediglich für die
240 Druckspalten der ersten Lieferung nachgetragenen Stichwörter hat Alan Kirkness im Grimmforum veröffentlicht.
Weit
zahlreicher noch als diese neuen Stichwörter sind jedoch die Notizen zu
Bedeutungsvarianten, nachgetragene Belege über die frühere Verwendung
der Wörter und ähnliches. Jacob Grimms Krakauer Exemplar mit solchen
Nachträgen umfaßt den gesamten Bereich A bis F, den die Brüder Grimm
selbst bearbeiten konnten. Auch zum Buchstaben D, an dem sein Bruder
tätig war, notierte er zahlreiche Nachträge, wie die mittlerweile
vorliegenden Probescans zeigen. Die Dichte der Nachträge nimmt aber
naturgemäß gegen das Ende ab, da Jacob Grimm nur noch wenig Lebenszeit
für solche Nachträge blieb und die Nachträge offenbar vor allem als
Nebenprodukte der Ausarbeitung neuer Artikel zustandekamen, also erst
dann wieder in vermehrtem Umfang, als er an den Buchstaben E und F
arbeitete.
Ein ähnliches Exemplar Wilhelm Grimms, allerdings nur
für den Bereich des ersten Buchhandelsbandes A bis BIERMOLKE, befindet
sich wie gesagt im Museum Haldensleben. Sicherlich hat er auch für den
Rest des B, für C, möglicherweise auch für den von ihm bearbeiteten
Buchstaben D ähnliche Nachträge vorgenommen. Da er 1859 unmittelbar
nach Abschluß des D starb, blieben diese Bögen vermutlich ungebunden.
Wo sie sich befinden, ist (noch) nicht bekannt. Im Bereich A / B sind
Wilhelm Grimms Nachträge zur Arbeit seines Bruders ganz ähnlicher Art
wie dessen Nachträge in seinem Exemplar. Neben Korrekturen von Fehlern
gibt es neu angesetzte Stichwörter ebenso wie nachgetragene Belege und
Bedeutungserklärungen.
Jacob Grimms Arbeit am Wörterbuch kann
neuerdings nicht nur anhand des Briefwechsels und der verschiedenen
Arbeitsmaterialien nachverfolgt werden, sondern im “Brüder Grimm
Gedenken” 16 erscheint ein von ihm selbst angelegtes Protokoll seiner
Arbeit, das fast vom Anfang der Arbeiten bis genau zum letzten
Stichwort FRUCHT reicht, zu dem er den Artikel noch begann. Die Blätter
des Protokolls befanden sich unidentifiziert an verschiedenen Stellen
des Grimm-Nachlasses in Berlin und Marburg und wurden letztes Jahr
vollständig aufgefunden und zusammengefügt.
Über die genannten
und über andere Dokumente aus der Wörterbuchwerkstatt der Brüder Grimm
informiert außer dem neuen Band “Brüder Grimm Gedenken” auch eine
Veranstaltung am Gründonnerstag, 13. April, 16 Uhr bei der
Grimm-Sozietät zu Berlin e. V., gegr. 1991, in der Jägerstraße 10—11 in
Berlin. Interessierte sind herzlich willkommen!
(BF, ACK) |
|